Autor mit Familientradition in Ostfriesland Wie die Weltgeschichte den einzelnen Menschen prägt
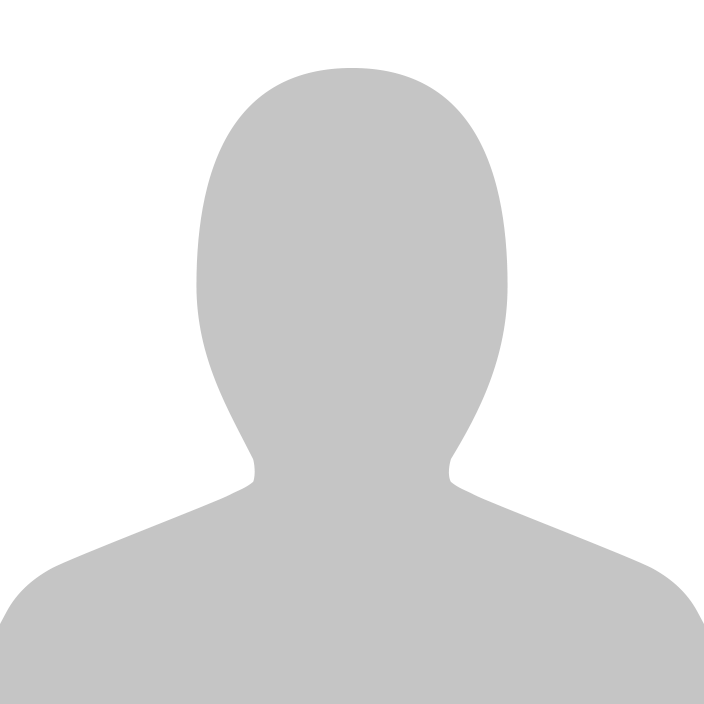

Michael Basse ist ein Autor mit langer Familientradition in Ostfriesland. Sein neuer Roman „Yank Zone“ ist ein eloquenter Ritt durch die Zeit.
München/Norden - Wer in Norden und Umgebung den Namen Basse nennt, der kann sich sicher sein, dass die Leute wissend nicken. Eine wichtige Familie, seit Generationen. Charlotte Basse ist in sechster Generation Geschäftsführerin des „Ostfriesischen Kuriers“, ihr 2018 verstorbener Vater Christian Basse war einer der mächtigsten ostfriesischen Verleger, und die Großmutter Ursula Basse-Soltau führte nach Lehr- und Wanderjahren kreuz und quer durch die Republik den Verlag nicht nur kaufmännisch, sondern mehrere Jahre auch als Chefredakteurin.
Einer fehlt in dieser Auflistung. Es ist Michael Basse, jüngerer Bruder von Christian und Onkel von Charlotte Basse. Auch ein Mann des Wortes. Kein Ostfriese, aber mit Zug in die Heimat seiner Familie. Seit Jahrzehnten in München lebend. Gerade hat der 65-jährige gelernte Journalist, der seit sieben Jahren als freier Schriftsteller sein Brot verdient, einen neuen Roman herausgebracht: „Yank Zone“.
Als Deutschland noch besetztes Land war
Der gebürtige Ostwestfale kam dank des Berufs des Vaters - er war ein evangelischer Pastor - weit herum, prägende Jahre erlebte er im schwäbischen Maulbronn, wo er im altehrwürdigen „Evangelischen Seminar“ auch sein Abitur ablegte. Genau dort in Maulbronn spielt auch „Yank Zone“, eine Verballhornung der einstigen amerikanischen Zone aus der Zeit, als Deutschland noch ein besetztes Land war und in Niedersachsen die Briten das Sagen hatten.
Das Buch
Michael Basse „Yank Zone“, Alfred Kröner Verlag (Edition Klöpfer), ISBN 978-3-520-76201-6, 25 Euro.
Ross Raymond Hartman, genannt „Old Chop“, ein hochdekorierter amerikanischer Kriegsheld im Ruhestand, hat allerdings nichts von einem Besatzer. Auf Wunsch seiner schwer kranken Frau war er in deren schwäbische Heimat zurückgekehrt. Jetzt, nach deren Tod kümmert er sich um seinen halbwüchsigen Sohn Jack. Und um dessen Freund Mani, einen revolutionsbereiten Klosterschüler, den es an schulfreien Tagen in diese „Männer-WG“ zieht, statt zu den spießigen Eltern bei ihm zu Hause.
In den 70er Jahren spielt diese Geschichte zweier Jungen, die sich die Blutsbrüderschaft geschworen haben, deren Lebensläufe aber stark auseinander gingen, um sich dann nach bald 30 Jahren, leider zu spät, doch wieder anzunähern.
Verschiedene Zeitebenen werden verknüpft
Michael Basse erzählt aus verschiedenen Ich-Perspektiven. Er verknüpft die Zeitebenen eloquent. In kurzen Sätzen und einer klaren, eindeutigen Sprache bringt er den Lesern eine Zeit näher, als Provinz noch wirklich Provinz war, als ein ausschließlich analoges Leben einem ruhigen Fluss glich und Kriegsdienstverweigerung als Akt des Verrats galt. Amerika als Sehnsuchtsort und das erste eigene Auto als Symbol des Erwachsenwerdens.
Von „Fräuleins“ und ihren großen Träumen
Aus dieser Kernerzählung heraus schlägt Basse weite Bögen: zur „Stunde Null“ etwa, als viele lebenshungrige junge Frauen auf Arbeitssuche in die Großstädte kamen und als „Fräuleins“, als „Yank’s sweethearts“ ein kleines, oft kurzes Glück fanden, das vielleicht sogar mit einem Neuanfang im Land der Träume, den Vereinigten Staaten, verbunden war. Ein weiterer Erzählstrang berichtet von der hoch intelligenten, gebildeten Lydia aus Sofia, die nach Ende des Kalten Kriegs von Jacks Auftreten angezogen, ihr post-sowjetisches Heimatland verlässt, um erneut enttäuscht zu werden.
„Yank Zone“ erzählt, wie durch das Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen etwas Neues, eigenes entsteht. Er erzählt aber auch, wie Weltgeschichte die Menschen prägt und wie viel wahrscheinlicher es ist, am Ende ein Verlierer zu sein. „In jedem steckt ein Amerikaner, der herauskommen will“, sagt „Old Chop“ in maßloser Selbstüberschätzung. Und: „Am Ende (gibt es) nur zwei Arten von Menschen: Amerikaner und solche, die es werden wollen.“ Ach ja? Noch immer sind viele von „Old Chops“ Landsleuten beseelt von diesem Gedanken, alle anderen finden diese Vorstellung nur maßlos und überheblich. Heute natürlich mehr als vor 50 Jahren.



