Wissenschaft
Zwei Forscher gucken Wind
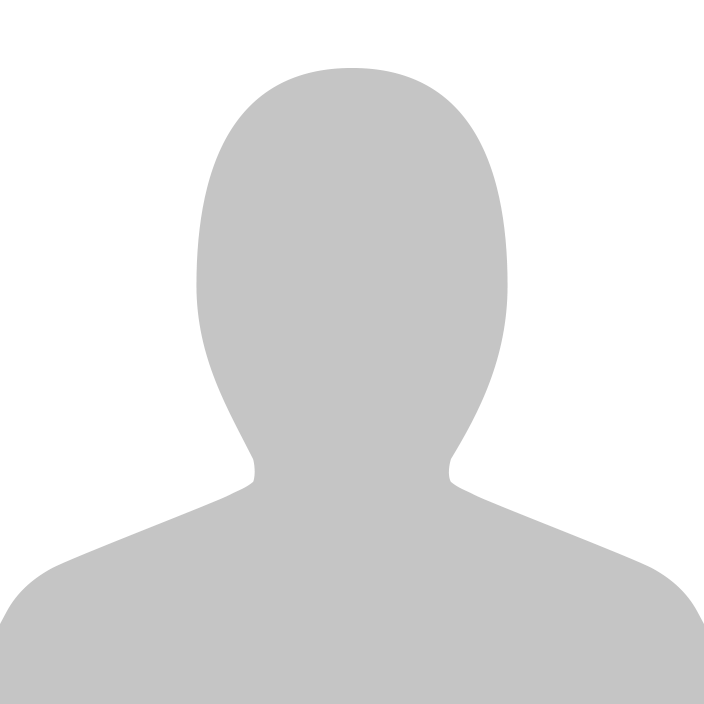

Auf Inseln in Ostfriesland und in Taiwan erforschen Wissenschaftler der Uni Hamburg die Bedeutung von Wind im Insulaner-Alltag. Dr. Martin Döring und Louisa Schneider sind auf Baltrum unterwegs.
Baltrum - Dr. Martin Döring und Louisa Schneider laufen systematisch die Straßen der kleinen Insel Baltrum ab. Sie suchen nach Zeichen von Wind. Hier entdecken sie einen Fahnenmast, dort einen Windanzeiger auf dem Dach, dort eine kleine Windmühle im Garten und da drüben einen Windschutz aus Plexiglas vor einer Terrasse. All das notieren sie zusammen mit der Hausnummer, und tragen es, nach Kategorien sortiert, in eine Karte von Baltrum ein.
Die beiden Wissenschaftler der Universität Hamburg machen derzeit eine Feldstudie zum Thema Windkultur. Sie ist Teil des CUORE-Projektes. Über einen Zeitraum von drei Jahren findet diese Forschung nicht nur auf Baltrum statt, sondern auch auf Norderney und auf Penghu in Taiwan. Am Ende sollen die Ergebnisse ausgetauscht und miteinander verglichen werden. „Wir wollen wissen, wie sehr Stürme den Alltag der Insulaner beeinflussen und letztlich auch lernen, wie wir alle besser mit Stürmen umgehen können“, erläutert Dr. Martin Döring.

„Was tun Sie, wenn ein Sturm angekündigt wird?“
Neben der Kartierung führen er und Louisa Schneider im Laufe von zweieinhalb Wochen insgesamt 14 Interviews mit den Insulanern. Um die Studien vergleichbar zu machen, haben sie Fragebögen entwickelt: Wie erfahren Sie von einem Sturm? Haben Sie als Kind etwas über Wind und Stürme in der Schule gelernt? Welches Sturmereignis ist Ihnen besonders in Erinnerung und warum? Versorgen Sie sich mit Notvorräten? Das sind nur einige der insgesamt 43 Fragen, die den Insulanern – sowohl in Ostfriesland als auch in Taiwan – gestellt werden.
„Eine Frage, die von allen Baltrumern bislang gleich beantwortet wird, ist: ,Was tun Sie, wenn ein Sturm angekündigt wird?‘“, gibt Louisa Schneider, seit Oktober wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geografie, ein Beispiel. „Alle sagen, sie gehen erst mal ums Haus, räumen alles weg, was wegfliegen könnte und versichern sich, dass alle Fenster geschlossen sind“, so Louisa Schneider. „Der Umgang mit Wind und Sturm ist für die Insulaner derart selbstverständlich, dass er ihnen gar nicht mehr bewusst ist“, erläutert Martin Döring. „Sie müssen ihre Winderlebnisse erst mal richtig aus ihrem Gedächtnis hervorkramen“, hat er bei den Interviews beobachtet. Auch einige Namen von Häusern auf Baltrum deuten auf die Windkultur im Alltag hin. „Das Haus ,Sturmeck‘ heißt nicht zu touristischen Zwecken so, sondern weil der Sturm an diesem Haus besonders um die Ecke pfeift.“

Insbesondere an der Bauweise der Häuser lässt sich die Bedeutung des Windes im Alltag der Baltrumer gut erkennen. „Viele Häuser haben tief heruntergezogene Dächer, Windfänge oder einen Windschutz an den Terrassen, manche ducken sich in Mulden, die Dachpfannen sind speziell befestigt“, macht der Forscher auf Besonderheiten aufmerksam. „Das alles sind Zeichen von Wind im Alltag der Insulaner.“ Wenn alle Interviews zusammengetragen und alle Kartierungen eingezeichnet und mit Fotos versehen sind, wollen die Wissenschaftler in Workshops ihre Ergebnisse mit den Insulanern besprechen. „Damit stellen wir sicher, dass unserer Erkenntnisse richtig sind, dass wir nicht etwas interpretieren, was so gar nicht stimmt“, sagt Martin Döring. Erst dann komme es zu einem Austausch der Ergebnisse mit Taiwan. „Wenn wir die Ergebnisse miteinander vergleichen, können wir voneinander lernen“, so Döring. Das sei angesichts des bevorstehenden Klimawandels von enormer Bedeutung, ist der Wissenschaftler überzeugt.


