Wissenschaft
Lokaljournalisten sind die unabhängige Stimme der Region
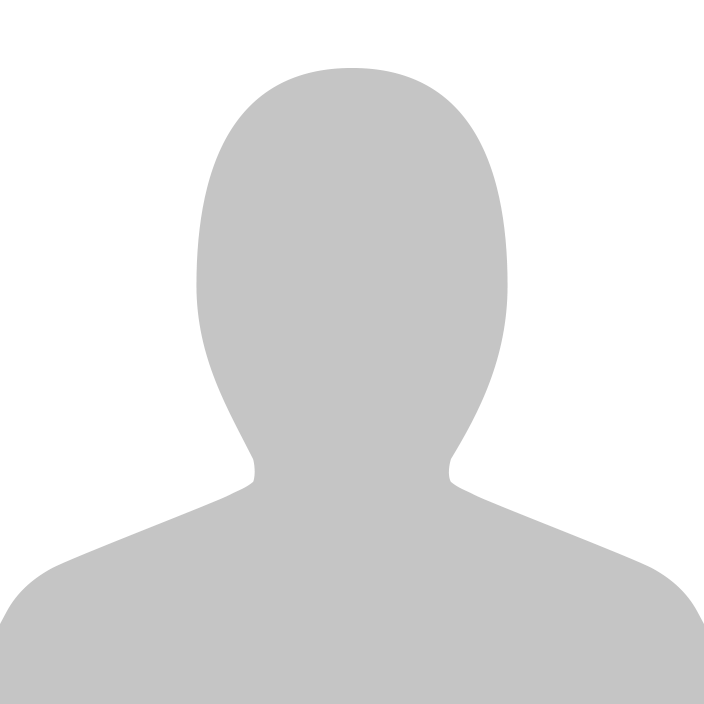
Mit OZ-Chefredakteur Joachim Braun spricht der Journalismus-Professor Klaus Meier über das Jahr 2033, die Berichterstattung in Corona-Zeiten und die Glaubwürdigkeit der Medien.
Eichstätt/Ostfriesland - Prof. Klaus Meier von der Katholischen Universität in Eichstätt (Bayern) ist einer der profiliertesten Journalismus-Forscher in Deutschland. Immer wieder meldet er sich öffentlich zu Wort, so im April, als er wegen „Einseitigkeit“ und „Panikmache“ in der Corona-Berichterstattung das öffentlich-rechtliche Fernsehen und überregionale Zeitungen kritisierte. In Ostfriesland war der 1968 geborene Ex-Lokalredakteur noch nie, wie er bekannte, als ihn OZ-Chefredakteur Joachim Braun zum Interview anlässlich des 70. Geburtstags unserer Zeitung anrief.
OZ: Welche Chancen sehen Sie für ein kleines unabhängiges Medienhaus wie die Zeitungsgruppe Ostfriesland den digitalen Wandel erfolgreich zu bewältigen?
Klaus Meier: Das kommt darauf an, wie wir Erfolg definieren. Ich würde mal in zwei Richtungen gehen. Wenn man von journalistischem Erfolg spricht, dann heißt das, dass man den Menschen auch im digitalen Raum Heimat gibt, mit verlässlichen Informationen aus dem Nahbereich, ihnen relevante Informationen bietet, die Orientierung bieten im täglichen Leben, in der heutigen Informationsflut. Da sehe ich große Chancen gerade für kleine Verlage, die ihre Wurzeln in der Region haben und dort bekannt und geschätzt sind. Die andere Seite ist die ökonomische, das Finanzierungsmodell der Tageszeitung, und da ist es in der gesamten westlichen Welt schwierig geworden, gerade für kleinere Verlage. Die Anzeigeneinnahmen sind schon lange rückläufig und jetzt in diesem Corona-Jahr noch viel stärker. Die Chance sehe ich darin, dass man die Menschen überzeugt, auch im digitalen Zeitalter für die journalistische Leistung zu bezahlen.
OZ: Sie haben vor einiger Zeit angekündigt, dass es 2033, also in 13 Jahren, in Deutschland keine gedruckten Tageszeitungen mehr geben wird. Mein Verleger Robert Dunkmann ist überzeugt, dass er noch sehr lange Zeitungen drucken wird, natürlich in geringerer Auflage. Ich bin verwirrt, wer hat nun Recht?
Meier: (lacht) 2033 beruht auf einer einfachen Rechnung. Ich habe die Auflagenzahlen aus ganz Deutschland über die letzten 25 Jahre genommen und in die Zukunft verlängert. In Wahrheit wird es von Region zu Region sehr unterschiedlich sein. In Großstädten zum Beispiel ist die Situation für Lokalzeitungen viel schwieriger als in ländlichen Regionen. Auch im Osten Deutschlands ist es aus verschiedenen Gründen schwieriger. Aber es gibt auch Regionen, in denen es den Zeitungen nach wie vor ganz gut geht. Es kommt auch darauf an, wie dünn oder dicht besiedelt eine Region ist, das macht einen bedeutenden Unterschied bei den Zustellkosten. Und die werden zu einem entscheidenden Faktor in den nächsten Jahren. Es gibt dazu eine Studie, wonach sich in 40 Prozent aller deutschen Gemeinden in fünf Jahren die Zustellung der Zeitung nicht mehr lohnen wird. So teuer kann ein Abo gar nicht sein, dass sich das noch rechnet.
OZ: Sie haben Recht, das ist auch für unseren Verlag jetzt schon ein Riesenthema. Die Wege zu unseren Abonnenten sind weit in Ostfriesland ...
Meier: Da sind Sie tatsächlich nicht alleine. Es gibt ja Überlegungen, was man da macht. Am sinnvollsten ist es vermutlich, mit den Menschen zu reden, in der Hoffnung, dass die es verstehen. Und vielleicht lassen sie sich dann auf ein iPad ein, das man ihnen günstig überlässt, und dann bekommen sie ein digitales Abo. In meiner eigenen Verwandtschaft kenne ich viele ältere Menschen, die sich an ein iPad sehr gut gewöhnt haben. Aber es ist ein Umgewöhnungsprozess. Und ich gebe zu, ich mag auch das Papier am Morgen zum Kaffee.
OZ: Wir haben in Deutschland eine einzigartige Vielfalt an Zeitungen. Und in Ostfriesland ist die Situation noch außergewöhnlicher, weil es fast überall eine Lokalzeitung gibt und die Ostfriesen-Zeitung. Wird diese Vielfalt kaputtgehen?
Meier: Kaputtgehen ist drastisch formuliert. Aber ich bin sehr skeptisch, dass sich das noch lange halten kann. Man braucht ja nur zu rechnen: Wenn in einem Ort 1000 Leser sind, jeweils 500 bei der einen und 500 bei der anderen Zeitung. Wenn es nur eine Zeitung gäbe, dann wären es 1000 Leser. Das wäre von den Kosten her viel sinnvoller. Wir haben über Jahrzehnte gelobt, dass es super ist, wenn es mehr als eine Lokalzeitung pro Stadt gibt: Der Leser hat die Auswahl, die Redaktionen konkurrieren um die besten Recherchen, die besten Kommentare, und das hilft dem Lokaljournalismus. Aber vielleicht ist es gar nicht so dramatisch, wenn es nur eine Redaktion pro Region gibt. Es kommt dann auf deren Selbstverständnis an. Vielfalt muss dann eben in der einen Redaktion gelebt werden. Alle Meinungen ins Blatt oder ins digitale Produkt. Alle Positionen, alle Fragen.
OZ: Es gibt ja noch ein anderes Dilemma der Digitalisierung. Die großen Zeitungskonzerne programmieren mit hohem Aufwand eine App, ein digitales Produkt und rollen es dann über mehrere Zeitungstitel aus. Ein kleiner Verlag wie wir hat ähnliche Entwicklungskosten, aber ein viel kleineres Publikum. Wissen Sie da eine Lösung?
Meier: Ich glaube, dass auch für kleinere Verlage das Zauberwort Kooperation heißt, dass man sich Partner sucht, die eine ähnliche Größe haben, ähnliche Bedürfnisse und die vielleicht keine Konkurrenten sind, und dann gemeinsam Produkte entwickelt. Allein alles zu entwickeln ist ganz schwierig.
OZ: Corona hat auch bei uns für einen Schub gesorgt. Unser Journalismus ist gefragt, unsere Informationen, die Lebenshilfe. Auf der anderen Seite sind die Anzeigenmärkte eingebrochen, was unsere Finanzierung in Frage stellt. Das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht.
Meier: Sie hören mich tief durchatmen. Das ist eine Erfahrung, die auch viele andere Lokalzeitungen gemacht haben: einerseits die Anzeigen-Einbrüche, andererseits eine hohe Wertschätzung durch die Leser. Das Vertrauen in Journalismus ist gestiegen. Lokaler, regionaler Journalismus hat in den vergangenen Monaten viele Dinge ganz gut gemacht, die hoffentlich auch nach Corona bleiben. Zum Beispiel eine stärkere Abkehr vom Terminjournalismus hin zu Themenjournalismus – mit guten Recherchen. Die Journalisten vermittelten das Gefühl, im Auftrag des Lesers unterwegs zu sein, der viele Fragen hatte. Wenn sie das so mitnehmen können, dann ist das auch ein guter Rückenwind für die Zeit danach ...
OZ: ... Dabei haben gerade Sie doch in der Corona-Zeit starke Kritik am journalistischen Angebot geübt ...
Meier: Ja, aber meine Kritik bezog sich vor allem auf die überregionalen Zeitungen und aufs Fernsehen. Wir haben Panikmache gesehen und Verkündigungsjournalismus erlebt im Hinblick auf Regierungsentscheidungen. Da ist kaum hinterfragt worden. Lokaljournalisten haben das viel stärker kritisiert. Und jetzt müssen Gerichte aufarbeiten, mit welchen willkürlichen, nicht durchdachten Maßnahmen Politik und Behörden zentrale Grundrechte eingeschränkt haben – und noch immer einschränken. Politiker müssen es in der Demokratie hinnehmen, dass ihre Entscheidungen vielfältig öffentlich diskutiert und auch kritisiert werden – auch und vor allem in Krisenzeiten. Außerdem waren lokale Zeitungen sehr kreativ, wenn es darum ging, den Menschen praktische Hilfen im Umgang mit der Pandemie zu geben und Themen konstruktiv aufzugreifen, also mit Lösung, Hoffnung und Zuversicht.
OZ: Was zuletzt stark zugenommen hat, sind Mails und Leserbriefe von „Corona-Leugnern“, und ich gebe zu, wir haben große Schwierigkeiten, damit umzugehen. Wir sind keine ausgebildeten Virologen, und die Kritik geht sehr ins Detail. Andererseits wollen wir Pluralität abbilden, haben dann aber das Problem, dass wir einer kleinen Minderheit zu viel Aufmerksamkeit geben. Was empfehlen Sie?
Meier: Ja, darüber wird auch in der Branche viel diskutiert – oft mit Ratlosigkeit. Was die sogenannten Corona-Leugner so frustriert, bezieht sich häufig darauf, was sie in überregionalen Medien, vor allem dem Fernsehen, mitbekommen – diese panikmachende Alternativlosigkeit und dass Kritiker der politischen Maßnahmen als „Covidioten“ bezeichnet und mit Rechtsradikalen in einen Topf geworfen werden. Aber wie soll man dem im Lokalen begegnen? Sie haben treffend gesagt, dass Sie Pluralität widerspiegeln möchten. Das wäre überhaupt eine Leitlinie: Möglichst alle Positionen zu Wort kommen lassen. Natürlich gibt es die Grenze der Faktenüberprüfung, also Verschwörungsmythen sollten nicht ins Blatt: Zum Beispiel, dass es dieses Virus gar nicht gibt oder dass Bill Gates dahinter steckt, weil er alle Menschen impfen lassen möchte. Aber es gibt doch neben den durch die überregionalen Medien aufgebauten Chefvirologen eine ganze Reihe von differenzierten Wissenschaftlern und Ärzten, die man häufiger zu Wort kommen lassen könnte.
OZ: Reden wir auch mal über junge Leute. Wir haben in Print ja vor allem ältere Leser und im Digitalen mittelalte. Die Jüngeren hingegen vertrauen vor allem auf soziale Medien und lehnen klassische Medien weitgehend ab. Sie unterscheiden auch nicht so sehr zwischen den unterschiedlichen Medienarten. Was empfehlen Sie da?
Meier: Das ist ein schwieriges Thema. Es gibt eine Vielzahl von Studien über junge Menschen. Daraus kann man allerdings kein Patentrezept herleiten. Tatsache ist, die jungen Menschen sind digital unterwegs, vor allem in Netzwerken. Wenn man sie erreichen will, muss man da mitspielen. Mit einer gedruckten Zeitung oder einem linearen Fernsehprogramm wird man sie nicht erreichen können. Es gibt aber auch inhaltliche Ansätze: Das, was junge Menschen immer interessiert, sind Zukunftsfragen, Nachhaltigkeitsthemen, auch Jobperspektiven, die Umwelt. Sie suchen eher einen konstruktiven Ansatz, also Lösungen und nicht Probleme. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man junge Menschen ab und zu auch an der Zeitung mitwirken lassen würde. Das erweitert sicherlich den Blick auf die Welt.
OZ: Klingt gut, aber: Haben wir gerade bei Jüngeren nicht auch ein Problem mit der Medienkompetenz? Journalistische Medien sind ja die einzigen, die unabhängig und nicht interessengeleitet informieren und somit kein grundsätzliches Glaubwürdigkeitsdefizit haben.
Meier: Ja, definitiv. Aber man muss auch da differenzieren. Es gibt Lehrer, Schulen, die bei diesem Thema richtig gut sind, und es gibt auch junge Leute, die sehr sattelfest sind, darüber was glaubwürdige Quellen sind, die auch gerade die lokalen Medien kennen und denen vertrauen, ebenso wie den großen Marken wie Tagesschau, Spiegel oder Süddeutsche Zeitung. Bei einer aktuellen Befragung von Lehrern hat es aber tatsächlich auch haarsträubende Antworten gegeben, dass ein Teil von ihnen erhebliche Lücken beim Wissen über das Mediensystem und die Freiheit der Presse in Deutschland hat. Ich denke, dass Zeitungen hier noch mehr zur Aufklärung beitragen können. Journalisten haben in der Vergangenheit auch viel getan, in dem sie in die Schulen gegangen sind und mit Lehrern und Schülern über ihre Arbeit sprechen. Solche Aktionen – wie beispielsweise das Projekt „Zeitung in der Schule“ – müssten eigentlich staatlich gefördert und mit finanziert werden. Da geht es ja um die demokratische Bildung.
OZ: Sicherlich ist Demokratiebildung unsere am meisten unterschätzte Leistung. Politiker haben ja bisweilen auch ein zwiespältiges Verhältnis dazu, weil sie von uns kritisiert werden.
Meier: Da gebe ich Ihnen Recht, und ich kann das noch mal betonen, was Sie eben angedeutet haben. Die einzige Stimme in der digitalen Öffentlichkeit, die unabhängig spricht, ist die Stimme des Journalismus, gerade im Lokalen. Alle anderen verfolgen in der Öffentlichkeit eigene Interessen und sind nicht unabhängig. Noch mal, weil es so wichtig ist: Die Lokalzeitung ist die einzige unabhängige Stimme in der Region. Diese Unabhängigkeit muss sie natürlich täglich wieder beweisen. Denn wenn irgendwo der Geruch von Abhängigkeit aufkommt, dann ist es um die Glaubwürdigkeit geschehen. Und glaubwürdige Informationen gehören zur Demokratie wie sauberes Wasser zum Leben.



