Best of 2022 Wie ein Freund in Ukraine zum Feind wird – Emderin berichtet
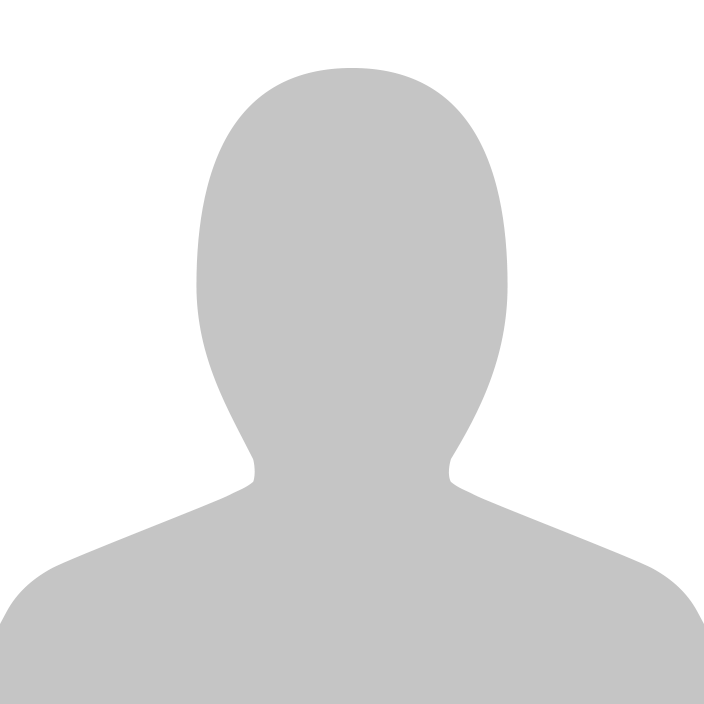

Liia Abdullina erlebte den sich anbahnenden Krieg in Donezk. „Alle wussten, dass es passiert“, sagt sie. Als der russische Einmarsch begann, war die Ärztin in Emden.
Was in der Ukraine passiert und seit dem 24. Februar täglich die Schlagzeilen bestimmt, lässt niemanden kalt. Was in Europa manchmal vergessen wird: Der Krieg hat schon viel früher angefangen. Liia Abdullina hat mir in sehr persönlichen Gesprächen geschildert, wie ihr Land zerreißt.
Emden - Am Tag, als nach internationaler Lesart die Invasion in der Ukraine begann, wurde Liia Abdullina vom Klingeln ihres Handys aufgeschreckt. „Ich war sofort hellwach“, sagt sie. Eine Freundin meldete sich aus Kiew. Sie berichtete von Raketenangriffen und bestätigte, was die junge Ärztin in Emden seit langem befürchtet hatte. Der Krieg in ihrer Heimat eskalierte. Es war der 24. Februar 2022, die russische Armee griff auf breiter Front an. „Alle wussten, dass es passiert“, sagt sie. Und doch habe sie das Erwartbare nicht glauben wollen.
Die 30-Jährige ist in Donezk groß geworden, im Osten der Ukraine, wo es seit vielen Jahren Gefechte gibt, Tote und Verwundete. Die Geräusche des Krieges, die fernen Detonationen, sind ihr vertraut. Sie kennt den Anblick von Panzern und Geschützen, deren Rohre aus Wäldchen ragen. Sie erzählt von einem Kommilitonen, der offen pro-ukrainisch auftrat und wohl genau deswegen eines Tages spurlos verschwand. An all das hatte sie sich in ihrer Jugend im Donbas irgendwie gewöhnt. Aber sie hat diesen Krieg nie gesehen. Jetzt ist er sichtbar, und offiziell – und Liia Abdullina ist weit weg, in Emden, wo sie seit November 2019 im Krankenhaus arbeitet.
Ein Land, das zerreißt
Wir treffen uns an einem warmen Maitag an einer Steinmauer am Stadtgraben. Es ist ein Wiedersehen. Kennengelernt habe ich die Medizinerin und Mutter eines sechsjährigen Sohnes in den Anfangstagen dessen, was als Ukraine-Krieg in die Geschichtsbücher eingeht. Als ein Helferteam um den Landtagsabgeordneten Matthias Arends (SPD) in der ersten Märzwoche Kriegsflüchtlinge von der ukrainisch-polnischen Grenze nach Emden brachte, half Abdullina den Neuankömmlingen als Übersetzerin. „Ich konnte nicht still sitzen“, sagt sie über diese Tage und Wochen. So kamen wir in Kontakt.

Ihr sehr persönlicher Bericht und ihre Schilderungen aus der Ukraine lassen sich nach journalistischen Maßstäben nicht überprüfen. Für ihre Glaubwürdigkeit spricht, dass die 30-Jährige nicht um dieses Gespräch gebeten hat. Sie beantwortet meine vielen Fragen und Nachfragen. Und sie klagt dabei niemanden an. Was sie zu erzählen hat, kann vielleicht helfen, auch in Ostfriesland besser zu verstehen, was dieser Krieg für die Menschen und ihre Familien im Donbas bedeutet. Ihre Geschichte ist die eines Landes, das zerreißt. Schon lange vor dem 24. Februar.
Die letzte Fahrt von Donezk
Liia Abdullina hat ihre Heimat deswegen früh verlassen. 2014 sei das gewesen, sagt sie. Die Situation in Donezk hatte sich seit Monaten immer weiter zugespitzt. Russland oder Ukraine? Russisch oder ukrainisch? Irgendwann habe sie einsehen müssen, dass sie nicht mehr beide Sprachen sprechen konnte, weil sie es nicht mehr durfte: „Es läuft nicht mehr parallel“, erkannte sie. Sie musste sich entscheiden. Und wählte die Ukraine.
Der Entschluss kam auch für sie unerwartet und impulsiv. Abdullina spricht von einem „Schlüsselmoment“. Sie erzählt von einer Fahrt im September 2014 von Donezk nach Kiew. Nach dem Abschluss ihres Medizinstudiums war sie in die Hauptstadt gezogen. „Ich habe eine Weiterbildung gemacht und als Notärztin beim Rettungsdienst gearbeitet.“ Auf dem Rückweg von einem ihrer Besuche bei ihren Eltern erreichte sie eine für sie noch immer ungewohnte Grenze – den Übergang zwischen der von Russland kontrollierten sogenannten Volksrepublik und der als frei geltenden Ukraine.
Von der Familie getrennt
Ein Angehöriger der Separatistenarmee habe den Bus betreten und die Ausweise der Passagiere verlangt. Sie schildert, wie unangenehm ihr der Mann und die Begegnung waren. „Es war kein Soldat“, sagt sie. Sein Auftritt habe völlig willkürlich und bedrohlich auf sie gewirkt. Sie hatte Angst. Als sie kurz darauf noch einmal von einem ukrainischen Grenzposten kontrolliert worden sei, habe sie die Situation ganz anders empfunden. Der Mann habe ukrainisch gesprochen und sei freundlich gewesen. Die Ankunft in der Ukraine habe sich „wie frische Luft“ angefühlt, beschreibt sie.

In Emden sagt sie im Rückblick, dass sie in dem Augenblick eine Entscheidung getroffen habe: Obwohl sie nur ihre Papiere und wenige Sachen in einem Rucksack dabei gehabt habe, habe sie ihrer Heimat, und mit ihr auch ihren Eltern und den meisten Verwandten den Rücken gekehrt. Bis heute. Fast alle leben nach wie vor in der Region Donezk. Der Kontakt zu ihrer überwiegend pro-russischen Familie sei nie abgerissen. Aber sie vermeiden es, über den Krieg und die Trennung zu sprechen. „Wir versuchen es zu ignorieren“, sagt Liia Abdullina.
Es wird gefährlich
Der Riss, der sich durch ihre Familie zieht, spaltet große Teile des Landes. Die Veränderungen hätten schon vor langer Zeit begonnen, erinnert sich die 30-Jährige. „Ich bin kein politischer Mensch, ich wollte nie etwas ändern. Ich habe immer nur beobachtet“, sagt sie. Was sie sah und was sie hörte, ist schwer zu verstehen: Es waren Erzählungen und Bilder vom Maidan, von Protesten gegen die ukrainische Regierung. Es waren Nachrichten von der Annexion der Krim durch Russland. Die Wahrheit verwischte. Und es wurde immer gefährlicher.
Es kamen Gerüchte auf, „komische Geschichten“, sagt Abdullina. Sie weiß noch, wie sehr sie sich erschreckt habe, als sie lange Listen mit den Geburtsdaten von Jugendlichen in ihrem Alter sah. Es waren die Namen von Demonstranten, die im Frühjahr 2014 auf dem Maidan in Kiew starben. Im Freundes- und Bekanntenkreis handelten Gespräche auf einmal davon, dass ukrainische Nazis unterwegs seien, die alle töten, die russisch sprechen. „Es wurde immer schwieriger, sich zu unterhalten“, so Abdullina. Sie habe es auch in der Familie gespürt. Ihr Vater, dessen Eltern überzeugte Kommunisten und Sowjets seien, verzweifelte zwischen all dem Gerede, den schlechten Klischees und der Propaganda.
Der Freund wird „mobilisiert“
Nach ihrem Umzug im November 2019 nach Emden verfolgte Liia Abdullina die Entwicklung nur noch aus der Ferne. Sie erzählt von einem Freund, den sie seit Schultagen kenne. Er habe sich früh den russischen Separatisten angeschlossen. Obwohl sie irgendwann auf zwei sehr unterschiedlichen Seiten standen, ist der Kontakt nicht abgebrochen, berichtet die 30-Jährige. Im März dieses Jahres schrieb der Freund, dass er „mobilisiert“ wurde. Er zog in den Krieg und wurde für Abdullina, seine ukrainische Freundin, damit faktisch zum Feind. Wo er kämpft und auf wen er schießt? Sie haben eine unausgesprochene Übereinkunft: „Er will es nicht sagen und ich will es nicht wissen“, sagt die Ärztin.
Die ersten Wochen des offenen russischen Angriffskriegs verfolgte sie rastlos aus der Ferne. Aus ihrer Heimat erreichten sie schreckliche Nachrichten. Eine Freundin aus Mariupol berichtete vom Tod ihres Partners, andere schilderten Eindrücke von Gefechtslärm, der Gewalt und der Zerstörung. Liia Abdullina musste irgendetwas tun. Sie fuhr zur polnisch-ukrainischen Grenzen, sie dolmetschte in Emden für geflüchtete Familien aus den Krisengebieten.
Die Zukunft nach dem Krieg
Mittlerweile sei sie etwas ruhiger geworden, sagt sie. Es ging nicht anders, sie drohte sich und ihre eigene kleine Familie in Emden in der Hilfe zu verlieren. Sie konzentriere sich jetzt „auf kleine Dinge“, so Abdullina, wie das Sammeln von Medikamenten, die sie in ihre Heimat schickt. Der Krieg, glaubt die Ärztin, werde noch lange dauern. „Alle hoffen, dass es schnell vorbei ist, aber die Realität zeigt etwas Anderes.“
Sie hat ein Ziel: Wenn eine Lösung gefunden worden ist, die Waffen schweigen und es eine freie Ukraine gibt, würde sie gerne dorthin fahren. Sie weiß, dass sie in ein anderes Land zurückkehrt. „Es wird etwas Neues nach dem Krieg entstehen“, sagt sie. Und sie wäre gerne dabei, „um die Medizin mit aufzubauen“.




