Erderwärmung Brasilien startet Klimagipfel mit Elan - Bilanz hat Kratzer
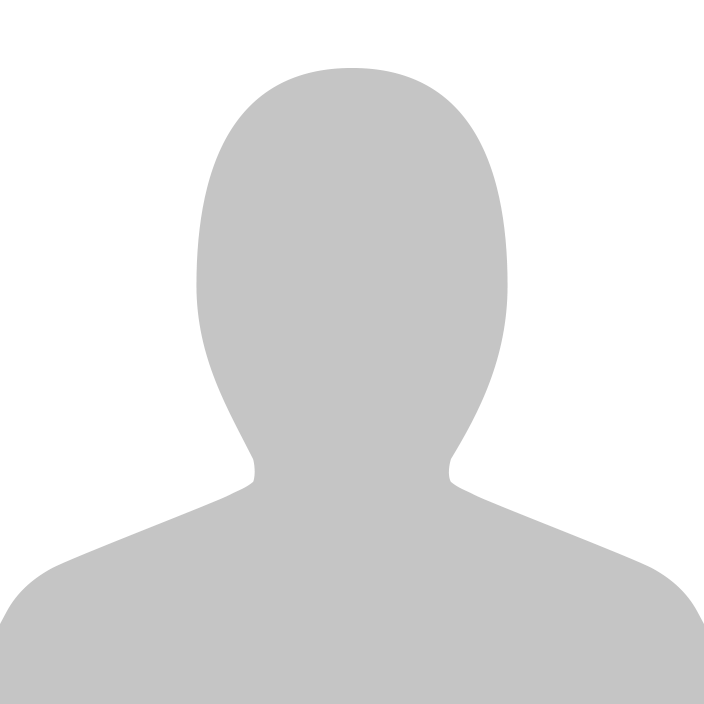

Neue Schnellstraße durch den Regenwald, Ölbohrungen am Amazonas, Kreuzfahrtschiffe als Hotels im Hafen: Wie glaubwürdig ist Brasilien beim Heimspiel auf der COP30?
Im zähen Kampf gegen die Klimakrise rühmt sich Brasilien als Vorkämpfer. Als Gastgeber der Weltklimakonferenz will Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den rund 200 Staaten ehrgeizige Beschlüsse abverlangen. Doch passt dazu der Bau einer neuen Schnellstraße durch den Regenwald zur Millionenstadt Belém? Und neue Öl-Bohrungen in der Amazonasmündung, die noch kurz vor der prestigeträchtigen Mammutkonferenz genehmigt wurden?
Klimaschützer äußerten sich im März empört über die breite Schneise für die Straße, der wertvolle Bäume zum Opfer fielen. Die Regionalregierung betont aber, Planung und Bau liefen schon seit Jahren und hätten mit der COP30 nichts zu tun.
Klimaschützer rügen Öl-Lizenz als Sabotageakt
Die umstrittenen Ölbohrungen des Petrobas-Konzerns verurteilte das Klimanetzwerk Observatório do clima als „Sabotageakt“ gegen die Klimakonferenz. Damit werde die von Lula beanspruchte Führungsrolle im Klimaschutz untergraben. Klagen von Umweltschützern laufen – doch ebenso die Bohrungen.
Und wie passt es zum auf Umweltschutz getrimmten Konzept, dass nun wochenlang zwei extra gecharterte Kreuzfahrtschiffe vor Belém ankern, um den riesigen Bedarf an Hotelbetten zu decken? Die unkonventionelle Lösung musste her, weil die Stadt logistisch gesehen am Limit ist: Für die zwei Wochen reisen etwa 50.000 Diplomaten, Journalisten und Aktivisten an.
Für die COP gesäubert und ausgebessert
In der wuseligen, schwülen Großstadt mit ihren bröckelnden Gehwegen und Gebäuden, verstopften Straßen und plärrenden Lautsprechern der vielen Straßenhändler wurde ganz offensichtlich einiges investiert, um zur COP30 optisch wenigstens punktuell zu glänzen: Etliche Plätze, Parks und auch Klärwerke wurden gesäubert und ausgebessert, die Bepflanzung auf Vordermann gebracht. Allein aus brasilianischen Bundesmitteln flossen dafür umgerechnet rund 650 Millionen Euro nach Belém, eine auch nach brasilianischen Maßstäben eher arme Stadt mit viel indigener Bevölkerung.
Was will Gastgeber Brasilien erreichen mit seiner symbolisch aufgeladenen COP30 am Rand des Regenwalds, genau zehn Jahre nach dem umjubelten Pariser Klimaabkommen? Präsident Lula spricht von einer „COP der Wahrheit“. Klimakonferenzen hätten seither viel beschlossen, aber die Staaten viel zu wenig geliefert. Sie hätten nun Gelegenheit, „die Ernsthaftigkeit ihres Engagements für den Planeten unter Beweis zu stellen“.
Konkret will Brasilien unter anderem zwei Vorhaben pushen: Schon auf einem vorgeschalteten Gipfel wurde ein neuer, milliardenschwerer Fonds zum Schutz tropischer Wälder in mehr als 70 Staaten angeschoben. Zum anderen will Lula mehr Mittel mobilisieren, um ärmeren Staaten die Anpassung an die fatalen Folgen der Erderhitzung zu erleichtern – also etwa heftigere und häufigere Dürren, Überschwemmungen, Stürme und Waldbrände. Der Bedarf ist gigantisch. Der neue UN-Report zur „Anpassungslücke“ zeigt, dass Entwicklungsländer bis 2035 jährlich mindestens 310 Milliarden US-Dollar (268 Milliarden Euro) brauchen, um sich an die Erderwärmung anzupassen – das Zwölffache der derzeitigen internationalen öffentlichen Finanzmittel.
Gastgeber Lula: Die Natur beugt sich keinen Bomben
Die politische Großwetterlage ist aber rau und erschwert ehrgeizige Beschlüsse auf der COP30. Die Schlagzeilen werden beherrscht von Kriegen und Konflikten, sei es im Gazastreifen, der Ukraine oder im Sudan. Und mit den USA unter Donald Trump ist einer der größten Emittenten klimaschädlicher Treibhausgase aus dem Pariser Abkommen von 2015 ausgestiegen. In Belém wird das Land nicht hochrangig vertreten sein.
Die ungemütliche Lage kennt auch Lula, der vor einer Abkehr vom Multilateralismus und nationalistischen Tendenzen warnt. Schon vor Wochen mahnte er in New York, niemand sei vor den Folgen des Klimawandels sicher. „Mauern an den Grenzen können weder Dürren noch Stürme aufhalten. Die Natur beugt sich weder Bomben noch Kriegsschiffen.“
Brasilien top bei Erneuerbaren, aber auch im Öl-Business
Doch ist auch Brasiliens eigene Bilanz in puncto Klimaschutz widersprüchlich. Zwar kommen 90 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien wie Wasserkraft – ein einsamer Spitzenwert unter den G20-Staaten. Doch rangiert es auch bei der Ölförderung in der weltweiten Rangliste unter den Top Ten. Öl ist inzwischen das Haupt-Exportgut, noch vor Sojabohnen.
Das Land rühmt sich einerseits, wie sehr der heimische Regenwald das Weltklima stabilisiert. Doch zugleich gehen weiter jedes Jahr riesige Flächen verloren – wenn auch zuletzt in gebremstem Tempo. Und: Brasilien ist der weltweit größte Exporteur von Rindfleisch, dessen Klimabilanz wegen der Methan-Ausscheidungen der Tiere ganz besonders klimaschädlich ist.
Schon vor dem offiziellen Start der COP30 waren am Donnerstag und Freitag Dutzende Staats- und Regierungschefs in Belém, darunter Kanzler Friedrich Merz (CDU). Immerhin etwas Rückenwind für die eigentliche Konferenz brachte der Gipfel: Neben dem Start des Tropenwald-Fonds gab es Erklärungen zur besseren Bekämpfung von Waldbränden sowie zum globalen Kampf gegen Armut und Hunger wegen der Klimakrise – alles unterstützt von jeweils vielen Dutzend Delegationen.
Erstmals seit Jahren wieder sichtbare Proteste möglich
Einen positiven Unterschied macht, dass die diesjährige COP erstmals seit Jahren in einem demokratischen Rechtsstaat stattfindet und nicht wie zuletzt in autoritär regierten Ländern wie Aserbaidschan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Deren repressive Sicherheitsbehörden hatten Demonstrationen und Kundgebungen von Klimaaktivisten rigoros untersagt und nur auf dem abgeschotteten COP-Gelände selbst geduldet. Anders jetzt: Zur Halbzeit der Konferenz Mitte November sind Proteste auch im Zentrum Beléms geplant, flankiert von weiteren „Klimastreiks“ rund um den Globus.
Dabei dürften die indigenen Gemeinschaften, die traditionellen Hüter des Regenwalds, eine wichtige Rolle spielen. In Regionen, in denen sie über verbriefte Landrechte verfügen, wird Studien zufolge weniger Wald abgeholzt als anderswo. Rund 3.000 indigene Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt werden in Belém erwartet - laut Regierung sei das „die größte Beteiligung indigener Völker in der Geschichte der Konferenz“. „Die Verteidigung des Amazonasgebiets ist nicht nur ein Kampf für die Natur, sondern ein Kampf um unsere eigene Existenz“, sagte die brasilianische Indigene Kelly Guajajara.



